Liebe in Zeiten des Neoliberalismus
»Das Private ist politisch!« das meinen viele zu wissen. Dass aber vor allem auch das Politische privat ist, wird immer leicht vergessen.
Der Vorsitzende der Marx-Engels-Stiftung, Werner Seppmann, zeigt in seinem "junge Welt"-Artikel diesen Zusammenhang auf. Er stellt den Doppelcharakter »romantischer Liebe« in Klassengesellschaften dar: Einerseits »Flucht aus dem Alltag«, also regressive Widerspruchsverarbeitung, aber andererseits auch die »subversive Kraft«, die in dem ungebrochenen Bedürfnis nach Selbstentfaltung und Selbstbefreiung zum Ausdruck kommt.
© Werner Seppmann, in: junge Welt vom 24.08.06
Über das Streben nach erfüllter Zweisamkeit unter den Bedingungen eines entfesselten Marktes
Eigentlich widerspricht es den im Trend liegenden »individualisierten« Existenzbedingungen, daß traditionelle Vorstellungen über lebenspartnerschaftliche Gemeinsamkeiten sich eines wachsenden Zuspruchs erfreuen. Nicht nur Liebe und romantisch verklärte Treuevorstellungen, sondern auch Ehe und Familie behaupten einen hohen und nicht zuletzt bei Jugendlichen (wie die Shell-Jugendstudien der letzten Jahre für die Bundesrepublik belegt haben) sogar steigenden Stellenwert. Diese Wertschätzung einer vertrauensvollen Zweisamkeit korrespondiert aber nicht unbedingt mit der Alltagspraxis. Denn das partnerschaftliche Zusammenleben ist, wie nicht nur die steigenden Scheidungsraten dokumentieren, offensichtlich schwieriger geworden. Standen in der Bundesrepublik 1970 noch 575000 Eheschließungen einer Zahl von 104000 Scheidungen gegenüber, so ließen sich 2003 383000 Paare trauen, vollzogen aber auch 214000 die amtliche Trennung. Diese (in allen kapitalistischen Industrieländern ähnlich verlaufende) Entwicklung könnte mit einer gewissen Genugtuung als der Schwanengesang einer historisch überholten Institutionalisierung des Zusammenlebens verstanden werden. Jedoch ist bei einer Bewertung dieser Entwicklung Vorsicht angebracht, denn es befindet sich nicht nur die Ehe in der Krise. Auch die Zahl der Alleinerziehenden hat zugenommen, weil deren Partnerschaften auch ohne Trauschein gescheitert sind: Von den unverheirateten Paaren beschlossen 2003 sogar mehr als 400000 eigene Wege zu gehen (alle Zahlen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes).
Pluralisierte Lebensstile?
In beiden Konstellationen, dem staatlich sanktionierten wie auch dem »informellen« Zusammenleben, ist offensichtlich die Leidensbereitschaft und Zumutbarkeitsschwelle gesunken. Vor allen Dingen bei Frauen ist die Bereitschaft gewachsen, wieder eigenständige Lebenswege zu gehen, wenn ihnen ein weiteres Zusammenleben sinnlos erscheint. Doch ist diese Form lebenspraktischer »Selbstbestimmung« oft mit viel Leid und Verzweiflung für die sich trennenden Partner, aber auch ihrer Kinder verbunden, so daß es leichtfertig wäre, sie mit den medienwirksamen Formeln einer individualisierungstheoretischen Sozialmythologie zu belegen, die auch noch in dem Scheitern von Lebensentwürfen und den damit sehr oft verbundenen Weg in die Zonen der sozialen Gefährdung eine »Pluralisierung der Lebensstile« erkennen will.
Stillschweigend wird bei dieser Begriffsfassade vorausgesetzt, daß es sich bei der Wahl der Lebensstilmuster grundsätzlich um autonome, von den strukturellen Existenzvoraussetzungen weitgehend unabhängige Entscheidungen handelt. Das mag bei studentischen Wohngemeinschaften und bei einer kleinen Zahl beruflich qualifizierter und gut verdienender Singles gelten. Jedoch auch bei ihnen ist eine so leichthändige Zurechnung nicht weniger problematisch, als bei den meisten alleinerziehenden Vätern und Müttern oder den »Wochenendpartnerschaften«. Viele dieser »pluralisierten« Lebensformen können nur durch interpretatorische Willkür als Ausdruck einer sozial voraussetzungslosen Gestaltungskompetenz begriffen werden: Man muß wohl schon deutscher Soziologieprofessor sein, um angesichts zunehmender ökonomischer Zwänge, sozialer Destruktionstendenzen und des allgemein verbreiteten Gefühls der Hilflosigkeit (»Man kann ja doch nichts machen!«) so unreflektiert wie Karl Ott0 Hondrich von einer »Welle hin zur Freiheit« zu reden, die es nicht nur als »politische und ökonomische Freiheit«, sondern auch bei der Partnerschafts- und Lebensstilwahl gebe.
Diese Sicht hat mit der gesellschaftlichen Realität wenig zu tun. Sozialforschungen, die überhaupt noch solchen Fragen nachgehen, zeigen ein Paarungsverhalten, daß die Klassen- und Schichtgrenzen nur selten überschreitet. Statt Ausdruck einer grenzenlosen Gestaltungsfreiheit zu sein, erweist sich Partnerwahl als klassengesellschaftlicher Reproduktionsmechanismus. Soziale »Grenzen« werden bestenfalls bei der Verbindung mit einem Partner aus dem nächsthöheren oder nächstniedrigeren Sozialsegment »überschritten«.
Auch wenn die »Freiheiten« individualisierter Lebensverhältnisse sich in Grenzen halten, hat eine Transformation traditioneller Lebensformen stattgefunden, hat es auch positive Veränderungen gegeben, die nicht geringzuschätzen sind: Heute wird ein Zusammenleben ohne Trauschein gesellschaftlich kaum mehr geächtet und können (zumindest in den Städten Mitteleuropas) auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit stillschweigender Akzeptanz rechnen. Fragwürdige »Normalitäts«vorstellungen erodieren – und erleben ironischerweise ihre Wiederauferstehung in Versuchen (wie teilweise innerhalb des Feminismus), die eigenen sexuellen Präferenzen zu privilegieren. Dabei kann es dann passieren, daß die Verabsolutierung des eigenen Horizonts zu einer neuen Spießigkeit und einer demonstrativen Lustfeindlichkeit gerinnt.
Auch wenn die soziokulturellen Veränderungen eine Erweiterung individueller Gestaltungsoptionen darstellen, kann daraus jedoch nicht auf die Abwesenheit soziostruktureller Zwänge geschlossen werden. Denn das lebenspraktische Gesicht von »Individualisierung« ist Vereinzelung und Isolation. Ernsthaft kann nicht davon die Rede sein, daß die in Pflegeinstitutionen abgeschobenen alten Menschen oder alleinstehenden Frauen, die mit ihren Kindern einen trunksüchtigen und gewalttätigen Mann verlassen und zukünftig von sozialen Unterstützungsleistungen abhängig sind, ihren »Lebensstil pluralisieren« würden. Ebensowenig kann angenommen werden, daß die Lebensverhältnisse für jene fünf Millionen Kinder und Erwachsenen in einem positiven Sinne »vielgestaltiger« geworden sind, die innerhalb eines Jahrzehnts in der Bundesrepublik von Scheidungsverfahren betroffen waren und deren Lebenssituation sich deshalb einschneidend (und selten nur vorteilhaft) verändert hat.
»Dereguliertes« Leben
Sozialanalytisch seriös ist die Beschäftigung mit den Veränderungen und Aufsplitterungen der Organisationsmuster des privaten Lebens nicht von der Frage zu trennen, weshalb die Wünsche nach einem gemeinsamen Leben so oft scheitern, Liebe und Zuneigung immer seltener in der rauen Alltagswirklichkeit Bestand haben. Es müßte die Dramatik thematisiert werden, mit der sich die Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den letzten beiden Jahrzehnten verändert haben; es müßte zur Sprache kommen, daß durch die Radikalisierung der Kapitalverwertungsstrategien sich soziale Unsicherheit und ein zunehmender Bewährungsdruck verallgemeinert haben und immer stärker in die Privatsphäre hineinwirken. Auf der Basis von Zeitverträgen läßt sich kein Leben planen. Weil partnerschaftliche Lebensweisen ein Mindestmaß zusammenhängender und verläßlicher Zeitstrukturen zur Voraussetzung haben, ist den entgrenzten Ansprüchen im Arbeitsalltag oft nur durch die »individualisierte« Gestaltung der privaten Lebensverhältnisse zu entsprechen.
Es bleibt für das Zusammenleben auch nicht ohne Konsequenzen, daß immer mehr Existenzen unter dem Vorbehalt des Scheiterns stehen, weil die berufliche Integration in jungen Jahren sich immer schwieriger gestaltet und Arbeitslosigkeit sowie berufliche Dequalifizierungen fast jeden treffen können. Auch müssen immer größere Anstrengungen unternommen werden, um den sozialen Status zu sichern: »Während noch vor fünfzehn Jahren eine Mittelschichtsfamilie 50 Stunden in der Woche arbeiten mußte, um ihren Lebensstandard gesichert zu sehen, muß sie jetzt über 100 Stunden arbeiten, um dasselbe Niveau zu erreichen, und zwar in fragmentarisierten, flexiblen Arbeitszeiten, so daß sich allmählich die Substanzstruktur der Familie aufzulösen beginnt.« (O. Negt) Der »flexible Mensch« entwurzelt (R. Sennet), denn soziale Bindungen stehen einer ökonomischen Selbstverwertung im Wege, die allseitige Verfügbarkeit, grenzenlosen Zeiteinsatz und geographische Mobilität verlangt.
Mit der Beschleunigung der ökonomischen Reproduktionsgeschwindigkeit haben sich neue Anforderungen an die psychosoziale Reaktionsfähigkeit der Menschen entwickelt, die wiederum auf die zwischenmenschlichen Verhaltensweisen zurückwirken; tendenziell gleichen sich die alltäglichen Sozialstandards den Reaktionsmustern im Wirtschaftsleben an. Die Kurzfristigkeit der Perspektiven in der Arbeitswelt prägen zunehmend eine Haltung der Unverbindlichkeit im Privaten. Die im Berufsleben aufgezwungenen egoistischen bis asozialen Durchsetzungsstrategien äußern sich im privaten Leben in einem berechnenden Verhältnis zum Mitmenschen.
Liebe als Utopie
Angesichts zunehmender Beziehungskatastrophen mutet die ungebrochene Option für die Liebe deplaziert an. Doch gerade weil das herrschende Konkurrenzklima und die beruflichen Anforderungsprofile der vertraulichen Zuneigung und dem Streben nach Gemeinsamkeit wenig förderlich sind, verstärkt sich das Verlangen nach ihnen. Auf die sozialen und emotionalen Defiziterfahrungen reagieren die Menschen mit überspannten Glückserwartungen mit der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Das Verlangen nach verläßlichen Partnerschaften hat sich bei jungen Menschen als Ersatz für die erodierten Gesellschaftsutopien etabliert. Obwohl selbst der illusorische Schleier eines bürgerlichen Familienidylls zerrissen ist, hat er seine Funktion als Orientierungsmuster nicht eingebüßt: Ein »Bedürfnis nach Verläßlichkeit und Heimat geht in die Utopie der Familie ein, obwohl jedermann die Erosion der bürgerlichen Familienstrukturen mit Händen greifbar vor sich hat.« (O. Negt)
Die »romantische Liebe« war von Beginn an ein Krisensymptom: Sie wurde im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts (in literarischen Dokumenten) zu einer pathetischen Lebensäußerung stilisiert, nachdem die kapitalistische Rationalität in immer weitere Lebensbereiche eingebrochen war. Daraus, daß in einer bis dahin nicht gekannten Weise künstlerisch von der Liebe die Rede war, wurde später fälschlich geschlossen, daß ein sensibler Umgang der Geschlechter ein neuzeitliches Phänomen sei. Es wurde stillschweigend vorausgesetzt, daß das damalige Zeitalter die »romantische Liebe« erst »erfunden« habe. Tatsächlich gehört sie, wie die einschlägigen ethnologischen Studien dokumentieren, zum Grundvermögen des vergesellschafteten Menschen. Wie wäre auch sonst die thematische Konstanz des Liebesthemas in der Literatur aller Zeiten, ihre Idealisierung im Gilgamesch-Epos, der »Odyssee« Homers, im »Hohelied Salomons«, den Gedichten Walther von der Vogelweides oder die Tragik in »Romeo und Julia« zu erklären. Auch zum Zeitpunkt der politischen Etablierung der bürgerlichen Verhältnisse wurde dem zwischengeschlechtlichen Verhalten eine besondere Aufmerksamkeit erst in dem Moment zuteil, als es durch die sich ausbreitende Warenwirtschaft und der damit verbundenen Anonymisierung der Lebensverhältnisse bedroht wurde und tendenziell die »menschliche Würde [sich] in den Tauschwert aufgelöst« hatte (»Kommunistisches Manifest«: MEW 4, S. 465).
Die mit Weltfluchttendenzen verbundenen Liebesvorstellungen waren damals Ausdruck des Gefühls eines Verlustes – und dürfte es heute immer noch sein, weil auch die Liebe in den Sog der gesellschaftlichen Fragmentarisierungstendenzen, der Gefährdung sozialer Schutzräume und einer »Individualisierung« im Sinne von Vereinzelung geraten ist. Das Liebenwollen und das Liebenkönnen, der Wunsch nach Zweisamkeit und die Lebenspraxis in den neoliberalistischen Zeiten haben sich auseinanderentwickelt.
Nicht selten ist das Bemühen, den Verlust in einen Gewinn umzuinterpretieren. Mit Hilfe ideologischer Rationalisierungsformeln wird versucht, die individuellen Reaktionen auf die Fragmentarisierung der Existenzbedingungen als Ausdruck eines selbstbestimmten Lebensentwurfs erscheinen zu lassen. Jedoch ist es fraglich, ob besonders viele Menschen ohne den marktvermittelten Anpassungszwang bereit wären, ihr Leben als ein Provisorium einzurichten und sich der latenten Gefahr sozialer Isolierung auszuliefern. Die »freiwillige« Wahl dieser Existenzformen entlarvt sich bei genauerer Betrachtung als Konsequenz beruflicher Zwänge oder allgemeiner Lebensumstände (die meisten »Singles« sind ältere Menschen).
»Individualisiertes« Elend
Die Tendenzen zur Vereinzelung und sozialen Beziehungslosigkeit, auch zur sozialdarwinistischen Verachtung der Mitmenschen und zur Entwicklung von Selbsthaßsyndromen, sind Spiegelbild eines Lebens im Zeichen steter Unsicherheit und eines permanenten Bewährungsdrucks. Um in der Risikogesellschaft zu bestehen, müssen die Menschen die Disziplin und Zweckrationalität verinnerlichen, sie zu Maximen ihres Lebens machen: Leistung und Erfolg werden zu Imperativen allen Denkens und Handelns. Um sozial nicht zu unterliegen, müssen die Menschen ein zwanghaftes Verhältnis zu sich selbst einnehmen und bereit sein, Tag für Tag ein Stück der eigenen Emotionalität zu Markte zu tragen und ihre soziale Sensibilität zu beschädigen.
Besonders durch einen Blick auf die Geschlechterverhältnisse wird das ganze gesellschaftlich produzierte psychische Elend sichtbar: Nicht nur in den literarischen Zustandsbeschreibungen wird das Sexualleben als emotionale Wüste geschildert. Die herrschende Trostlosigkeit und die Intensität der Selbstentfremdung wird von vielen sexualwissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt, die eine Tendenz zur Anonymisierung, Beziehungsarmut und emotionalen Kälte beschreiben. Mit dem Fernsehen, dem Telefon und dem Computer wird die Beziehungslosigkeit überspielt: Eros verschwindet tendenziell in den Maschinen. Triebvitalität wird ins Virtuelle übertragen, zwischenmenschliche Vereinigungsbedürfnisse auf Ersatzhandlungen reduziert.
Auch das Versprechen einer »sexuellen Revolution« ist von der bürgerlichen Gesellschaft nicht eingelöst worden. »Alle großen Untersuchungen des Sexualverhaltens – wirklich ausnahmslos alle, von Helsinki bis San Francisco – zeigen, daß weite Teile der heterosexuellen Welt zunehmend sexuell sehr inaktiv sind, während gleichzeitig auf Bildschirmen und Plakatwänden hitzig weitergemacht wird.« (M. Lau) Wenn aktuelle Erhebungswerte zutreffen, haben 35jährige Singles eine geringere Koitusrate als eine verheiratete 60jährige Hausfrau. Neueste Untersuchungsergebnisse lassen selbst daran zweifeln, ob zwischen den Jugendlichen der sexuelle Umgang unkomplizierter geworden ist, als es vor drei Jahrzehnten der Fall war. Sie wissen mehr über sexuelle Techniken, ohne aber daß von Aufklärung gesprochen werden kann, die ein erweitertes Maß an Selbstbestimmung ermöglichte.
Der Sexualforscher Volkmar Sigusch zeichnet die Welt der gegenwärtigen Sexualbeziehungen mit ihrem Egoismus und Dispersionen, ihren bizarren Ersatzhandlungen und narzißtischen Inszenierungspraktiken, ihrem kalten Selbstbefriedigungsdrang (der Kinderprostitution, Sextourismus und Gewaltpornographie mit einschließt) und ihrer ästhetisierten Lustlosigkeit als ein Horrorgemälde in der Tradition Hieronymus Boschs.
Selbsterfüllung und Solidarität
Doch auch die gescheiterte Liebe und das verfehlte Streben nach erotischer Erfüllung sind Ausdruck einer im Kern unkontrollierbaren und individuelle Selbstentfaltung reklamierenden Subjektivität. Das Bedürfnis nach Zuneigung, Liebe und Gemeinsamkeit kann immer wieder fehlgeleitet und enttäuscht, nicht aber ausgelöscht werden. Es besitzt eine subversive Kraft, weil sie das Streben nach einem erfüllten Leben durch das Verhältnis zu anderen thematisiert und daran erinnert, daß das Ich ohne das Du nicht existieren kann.
Der Widerspruch zwischen dem Streben nach erfüllter Zweisamkeit und einer entfremdeten Alltagspraxis verweist zwangsläufig darauf, daß eine gelungene Lebensgestaltung zu den objektiven Existenzbedingungen vermittelt ist. Solange durch die sozialen Strukturbedingungen ein erfülltes Leben eher behindert denn gefördert wird, verweist die Utopie der Liebe auf die konkrete Utopie einer solidarischen Gesellschaft: »Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen.« (Karl Marx: MEW 40, S. 567)
Der Vorsitzende der Marx-Engels-Stiftung, Werner Seppmann, zeigt in seinem "junge Welt"-Artikel diesen Zusammenhang auf. Er stellt den Doppelcharakter »romantischer Liebe« in Klassengesellschaften dar: Einerseits »Flucht aus dem Alltag«, also regressive Widerspruchsverarbeitung, aber andererseits auch die »subversive Kraft«, die in dem ungebrochenen Bedürfnis nach Selbstentfaltung und Selbstbefreiung zum Ausdruck kommt.
© Werner Seppmann, in: junge Welt vom 24.08.06
Über das Streben nach erfüllter Zweisamkeit unter den Bedingungen eines entfesselten Marktes
Eigentlich widerspricht es den im Trend liegenden »individualisierten« Existenzbedingungen, daß traditionelle Vorstellungen über lebenspartnerschaftliche Gemeinsamkeiten sich eines wachsenden Zuspruchs erfreuen. Nicht nur Liebe und romantisch verklärte Treuevorstellungen, sondern auch Ehe und Familie behaupten einen hohen und nicht zuletzt bei Jugendlichen (wie die Shell-Jugendstudien der letzten Jahre für die Bundesrepublik belegt haben) sogar steigenden Stellenwert. Diese Wertschätzung einer vertrauensvollen Zweisamkeit korrespondiert aber nicht unbedingt mit der Alltagspraxis. Denn das partnerschaftliche Zusammenleben ist, wie nicht nur die steigenden Scheidungsraten dokumentieren, offensichtlich schwieriger geworden. Standen in der Bundesrepublik 1970 noch 575000 Eheschließungen einer Zahl von 104000 Scheidungen gegenüber, so ließen sich 2003 383000 Paare trauen, vollzogen aber auch 214000 die amtliche Trennung. Diese (in allen kapitalistischen Industrieländern ähnlich verlaufende) Entwicklung könnte mit einer gewissen Genugtuung als der Schwanengesang einer historisch überholten Institutionalisierung des Zusammenlebens verstanden werden. Jedoch ist bei einer Bewertung dieser Entwicklung Vorsicht angebracht, denn es befindet sich nicht nur die Ehe in der Krise. Auch die Zahl der Alleinerziehenden hat zugenommen, weil deren Partnerschaften auch ohne Trauschein gescheitert sind: Von den unverheirateten Paaren beschlossen 2003 sogar mehr als 400000 eigene Wege zu gehen (alle Zahlen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes).
Pluralisierte Lebensstile?
In beiden Konstellationen, dem staatlich sanktionierten wie auch dem »informellen« Zusammenleben, ist offensichtlich die Leidensbereitschaft und Zumutbarkeitsschwelle gesunken. Vor allen Dingen bei Frauen ist die Bereitschaft gewachsen, wieder eigenständige Lebenswege zu gehen, wenn ihnen ein weiteres Zusammenleben sinnlos erscheint. Doch ist diese Form lebenspraktischer »Selbstbestimmung« oft mit viel Leid und Verzweiflung für die sich trennenden Partner, aber auch ihrer Kinder verbunden, so daß es leichtfertig wäre, sie mit den medienwirksamen Formeln einer individualisierungstheoretischen Sozialmythologie zu belegen, die auch noch in dem Scheitern von Lebensentwürfen und den damit sehr oft verbundenen Weg in die Zonen der sozialen Gefährdung eine »Pluralisierung der Lebensstile« erkennen will.
Stillschweigend wird bei dieser Begriffsfassade vorausgesetzt, daß es sich bei der Wahl der Lebensstilmuster grundsätzlich um autonome, von den strukturellen Existenzvoraussetzungen weitgehend unabhängige Entscheidungen handelt. Das mag bei studentischen Wohngemeinschaften und bei einer kleinen Zahl beruflich qualifizierter und gut verdienender Singles gelten. Jedoch auch bei ihnen ist eine so leichthändige Zurechnung nicht weniger problematisch, als bei den meisten alleinerziehenden Vätern und Müttern oder den »Wochenendpartnerschaften«. Viele dieser »pluralisierten« Lebensformen können nur durch interpretatorische Willkür als Ausdruck einer sozial voraussetzungslosen Gestaltungskompetenz begriffen werden: Man muß wohl schon deutscher Soziologieprofessor sein, um angesichts zunehmender ökonomischer Zwänge, sozialer Destruktionstendenzen und des allgemein verbreiteten Gefühls der Hilflosigkeit (»Man kann ja doch nichts machen!«) so unreflektiert wie Karl Ott0 Hondrich von einer »Welle hin zur Freiheit« zu reden, die es nicht nur als »politische und ökonomische Freiheit«, sondern auch bei der Partnerschafts- und Lebensstilwahl gebe.
Diese Sicht hat mit der gesellschaftlichen Realität wenig zu tun. Sozialforschungen, die überhaupt noch solchen Fragen nachgehen, zeigen ein Paarungsverhalten, daß die Klassen- und Schichtgrenzen nur selten überschreitet. Statt Ausdruck einer grenzenlosen Gestaltungsfreiheit zu sein, erweist sich Partnerwahl als klassengesellschaftlicher Reproduktionsmechanismus. Soziale »Grenzen« werden bestenfalls bei der Verbindung mit einem Partner aus dem nächsthöheren oder nächstniedrigeren Sozialsegment »überschritten«.
Auch wenn die »Freiheiten« individualisierter Lebensverhältnisse sich in Grenzen halten, hat eine Transformation traditioneller Lebensformen stattgefunden, hat es auch positive Veränderungen gegeben, die nicht geringzuschätzen sind: Heute wird ein Zusammenleben ohne Trauschein gesellschaftlich kaum mehr geächtet und können (zumindest in den Städten Mitteleuropas) auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit stillschweigender Akzeptanz rechnen. Fragwürdige »Normalitäts«vorstellungen erodieren – und erleben ironischerweise ihre Wiederauferstehung in Versuchen (wie teilweise innerhalb des Feminismus), die eigenen sexuellen Präferenzen zu privilegieren. Dabei kann es dann passieren, daß die Verabsolutierung des eigenen Horizonts zu einer neuen Spießigkeit und einer demonstrativen Lustfeindlichkeit gerinnt.
Auch wenn die soziokulturellen Veränderungen eine Erweiterung individueller Gestaltungsoptionen darstellen, kann daraus jedoch nicht auf die Abwesenheit soziostruktureller Zwänge geschlossen werden. Denn das lebenspraktische Gesicht von »Individualisierung« ist Vereinzelung und Isolation. Ernsthaft kann nicht davon die Rede sein, daß die in Pflegeinstitutionen abgeschobenen alten Menschen oder alleinstehenden Frauen, die mit ihren Kindern einen trunksüchtigen und gewalttätigen Mann verlassen und zukünftig von sozialen Unterstützungsleistungen abhängig sind, ihren »Lebensstil pluralisieren« würden. Ebensowenig kann angenommen werden, daß die Lebensverhältnisse für jene fünf Millionen Kinder und Erwachsenen in einem positiven Sinne »vielgestaltiger« geworden sind, die innerhalb eines Jahrzehnts in der Bundesrepublik von Scheidungsverfahren betroffen waren und deren Lebenssituation sich deshalb einschneidend (und selten nur vorteilhaft) verändert hat.
»Dereguliertes« Leben
Sozialanalytisch seriös ist die Beschäftigung mit den Veränderungen und Aufsplitterungen der Organisationsmuster des privaten Lebens nicht von der Frage zu trennen, weshalb die Wünsche nach einem gemeinsamen Leben so oft scheitern, Liebe und Zuneigung immer seltener in der rauen Alltagswirklichkeit Bestand haben. Es müßte die Dramatik thematisiert werden, mit der sich die Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den letzten beiden Jahrzehnten verändert haben; es müßte zur Sprache kommen, daß durch die Radikalisierung der Kapitalverwertungsstrategien sich soziale Unsicherheit und ein zunehmender Bewährungsdruck verallgemeinert haben und immer stärker in die Privatsphäre hineinwirken. Auf der Basis von Zeitverträgen läßt sich kein Leben planen. Weil partnerschaftliche Lebensweisen ein Mindestmaß zusammenhängender und verläßlicher Zeitstrukturen zur Voraussetzung haben, ist den entgrenzten Ansprüchen im Arbeitsalltag oft nur durch die »individualisierte« Gestaltung der privaten Lebensverhältnisse zu entsprechen.
Es bleibt für das Zusammenleben auch nicht ohne Konsequenzen, daß immer mehr Existenzen unter dem Vorbehalt des Scheiterns stehen, weil die berufliche Integration in jungen Jahren sich immer schwieriger gestaltet und Arbeitslosigkeit sowie berufliche Dequalifizierungen fast jeden treffen können. Auch müssen immer größere Anstrengungen unternommen werden, um den sozialen Status zu sichern: »Während noch vor fünfzehn Jahren eine Mittelschichtsfamilie 50 Stunden in der Woche arbeiten mußte, um ihren Lebensstandard gesichert zu sehen, muß sie jetzt über 100 Stunden arbeiten, um dasselbe Niveau zu erreichen, und zwar in fragmentarisierten, flexiblen Arbeitszeiten, so daß sich allmählich die Substanzstruktur der Familie aufzulösen beginnt.« (O. Negt) Der »flexible Mensch« entwurzelt (R. Sennet), denn soziale Bindungen stehen einer ökonomischen Selbstverwertung im Wege, die allseitige Verfügbarkeit, grenzenlosen Zeiteinsatz und geographische Mobilität verlangt.
Mit der Beschleunigung der ökonomischen Reproduktionsgeschwindigkeit haben sich neue Anforderungen an die psychosoziale Reaktionsfähigkeit der Menschen entwickelt, die wiederum auf die zwischenmenschlichen Verhaltensweisen zurückwirken; tendenziell gleichen sich die alltäglichen Sozialstandards den Reaktionsmustern im Wirtschaftsleben an. Die Kurzfristigkeit der Perspektiven in der Arbeitswelt prägen zunehmend eine Haltung der Unverbindlichkeit im Privaten. Die im Berufsleben aufgezwungenen egoistischen bis asozialen Durchsetzungsstrategien äußern sich im privaten Leben in einem berechnenden Verhältnis zum Mitmenschen.
Liebe als Utopie
Angesichts zunehmender Beziehungskatastrophen mutet die ungebrochene Option für die Liebe deplaziert an. Doch gerade weil das herrschende Konkurrenzklima und die beruflichen Anforderungsprofile der vertraulichen Zuneigung und dem Streben nach Gemeinsamkeit wenig förderlich sind, verstärkt sich das Verlangen nach ihnen. Auf die sozialen und emotionalen Defiziterfahrungen reagieren die Menschen mit überspannten Glückserwartungen mit der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Das Verlangen nach verläßlichen Partnerschaften hat sich bei jungen Menschen als Ersatz für die erodierten Gesellschaftsutopien etabliert. Obwohl selbst der illusorische Schleier eines bürgerlichen Familienidylls zerrissen ist, hat er seine Funktion als Orientierungsmuster nicht eingebüßt: Ein »Bedürfnis nach Verläßlichkeit und Heimat geht in die Utopie der Familie ein, obwohl jedermann die Erosion der bürgerlichen Familienstrukturen mit Händen greifbar vor sich hat.« (O. Negt)
Die »romantische Liebe« war von Beginn an ein Krisensymptom: Sie wurde im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts (in literarischen Dokumenten) zu einer pathetischen Lebensäußerung stilisiert, nachdem die kapitalistische Rationalität in immer weitere Lebensbereiche eingebrochen war. Daraus, daß in einer bis dahin nicht gekannten Weise künstlerisch von der Liebe die Rede war, wurde später fälschlich geschlossen, daß ein sensibler Umgang der Geschlechter ein neuzeitliches Phänomen sei. Es wurde stillschweigend vorausgesetzt, daß das damalige Zeitalter die »romantische Liebe« erst »erfunden« habe. Tatsächlich gehört sie, wie die einschlägigen ethnologischen Studien dokumentieren, zum Grundvermögen des vergesellschafteten Menschen. Wie wäre auch sonst die thematische Konstanz des Liebesthemas in der Literatur aller Zeiten, ihre Idealisierung im Gilgamesch-Epos, der »Odyssee« Homers, im »Hohelied Salomons«, den Gedichten Walther von der Vogelweides oder die Tragik in »Romeo und Julia« zu erklären. Auch zum Zeitpunkt der politischen Etablierung der bürgerlichen Verhältnisse wurde dem zwischengeschlechtlichen Verhalten eine besondere Aufmerksamkeit erst in dem Moment zuteil, als es durch die sich ausbreitende Warenwirtschaft und der damit verbundenen Anonymisierung der Lebensverhältnisse bedroht wurde und tendenziell die »menschliche Würde [sich] in den Tauschwert aufgelöst« hatte (»Kommunistisches Manifest«: MEW 4, S. 465).
Die mit Weltfluchttendenzen verbundenen Liebesvorstellungen waren damals Ausdruck des Gefühls eines Verlustes – und dürfte es heute immer noch sein, weil auch die Liebe in den Sog der gesellschaftlichen Fragmentarisierungstendenzen, der Gefährdung sozialer Schutzräume und einer »Individualisierung« im Sinne von Vereinzelung geraten ist. Das Liebenwollen und das Liebenkönnen, der Wunsch nach Zweisamkeit und die Lebenspraxis in den neoliberalistischen Zeiten haben sich auseinanderentwickelt.
Nicht selten ist das Bemühen, den Verlust in einen Gewinn umzuinterpretieren. Mit Hilfe ideologischer Rationalisierungsformeln wird versucht, die individuellen Reaktionen auf die Fragmentarisierung der Existenzbedingungen als Ausdruck eines selbstbestimmten Lebensentwurfs erscheinen zu lassen. Jedoch ist es fraglich, ob besonders viele Menschen ohne den marktvermittelten Anpassungszwang bereit wären, ihr Leben als ein Provisorium einzurichten und sich der latenten Gefahr sozialer Isolierung auszuliefern. Die »freiwillige« Wahl dieser Existenzformen entlarvt sich bei genauerer Betrachtung als Konsequenz beruflicher Zwänge oder allgemeiner Lebensumstände (die meisten »Singles« sind ältere Menschen).
»Individualisiertes« Elend
Die Tendenzen zur Vereinzelung und sozialen Beziehungslosigkeit, auch zur sozialdarwinistischen Verachtung der Mitmenschen und zur Entwicklung von Selbsthaßsyndromen, sind Spiegelbild eines Lebens im Zeichen steter Unsicherheit und eines permanenten Bewährungsdrucks. Um in der Risikogesellschaft zu bestehen, müssen die Menschen die Disziplin und Zweckrationalität verinnerlichen, sie zu Maximen ihres Lebens machen: Leistung und Erfolg werden zu Imperativen allen Denkens und Handelns. Um sozial nicht zu unterliegen, müssen die Menschen ein zwanghaftes Verhältnis zu sich selbst einnehmen und bereit sein, Tag für Tag ein Stück der eigenen Emotionalität zu Markte zu tragen und ihre soziale Sensibilität zu beschädigen.
Besonders durch einen Blick auf die Geschlechterverhältnisse wird das ganze gesellschaftlich produzierte psychische Elend sichtbar: Nicht nur in den literarischen Zustandsbeschreibungen wird das Sexualleben als emotionale Wüste geschildert. Die herrschende Trostlosigkeit und die Intensität der Selbstentfremdung wird von vielen sexualwissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt, die eine Tendenz zur Anonymisierung, Beziehungsarmut und emotionalen Kälte beschreiben. Mit dem Fernsehen, dem Telefon und dem Computer wird die Beziehungslosigkeit überspielt: Eros verschwindet tendenziell in den Maschinen. Triebvitalität wird ins Virtuelle übertragen, zwischenmenschliche Vereinigungsbedürfnisse auf Ersatzhandlungen reduziert.
Auch das Versprechen einer »sexuellen Revolution« ist von der bürgerlichen Gesellschaft nicht eingelöst worden. »Alle großen Untersuchungen des Sexualverhaltens – wirklich ausnahmslos alle, von Helsinki bis San Francisco – zeigen, daß weite Teile der heterosexuellen Welt zunehmend sexuell sehr inaktiv sind, während gleichzeitig auf Bildschirmen und Plakatwänden hitzig weitergemacht wird.« (M. Lau) Wenn aktuelle Erhebungswerte zutreffen, haben 35jährige Singles eine geringere Koitusrate als eine verheiratete 60jährige Hausfrau. Neueste Untersuchungsergebnisse lassen selbst daran zweifeln, ob zwischen den Jugendlichen der sexuelle Umgang unkomplizierter geworden ist, als es vor drei Jahrzehnten der Fall war. Sie wissen mehr über sexuelle Techniken, ohne aber daß von Aufklärung gesprochen werden kann, die ein erweitertes Maß an Selbstbestimmung ermöglichte.
Der Sexualforscher Volkmar Sigusch zeichnet die Welt der gegenwärtigen Sexualbeziehungen mit ihrem Egoismus und Dispersionen, ihren bizarren Ersatzhandlungen und narzißtischen Inszenierungspraktiken, ihrem kalten Selbstbefriedigungsdrang (der Kinderprostitution, Sextourismus und Gewaltpornographie mit einschließt) und ihrer ästhetisierten Lustlosigkeit als ein Horrorgemälde in der Tradition Hieronymus Boschs.
Selbsterfüllung und Solidarität
Doch auch die gescheiterte Liebe und das verfehlte Streben nach erotischer Erfüllung sind Ausdruck einer im Kern unkontrollierbaren und individuelle Selbstentfaltung reklamierenden Subjektivität. Das Bedürfnis nach Zuneigung, Liebe und Gemeinsamkeit kann immer wieder fehlgeleitet und enttäuscht, nicht aber ausgelöscht werden. Es besitzt eine subversive Kraft, weil sie das Streben nach einem erfüllten Leben durch das Verhältnis zu anderen thematisiert und daran erinnert, daß das Ich ohne das Du nicht existieren kann.
Der Widerspruch zwischen dem Streben nach erfüllter Zweisamkeit und einer entfremdeten Alltagspraxis verweist zwangsläufig darauf, daß eine gelungene Lebensgestaltung zu den objektiven Existenzbedingungen vermittelt ist. Solange durch die sozialen Strukturbedingungen ein erfülltes Leben eher behindert denn gefördert wird, verweist die Utopie der Liebe auf die konkrete Utopie einer solidarischen Gesellschaft: »Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen.« (Karl Marx: MEW 40, S. 567)
compay - 25. Aug, 10:56










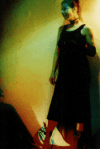








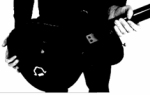





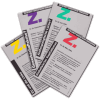







Trackback URL:
https://compay.twoday.net/stories/2577899/modTrackback